


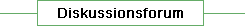
Zurück zum Forenbereich
»Rechtschreibung und -reform«
Beiträge zum Thema »Das ß in der Schweiz«
Älteste Beiträge zuoberst anzeigen | nach unten
|
Reinhard Markner Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2008 um 14.42 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3933 Es gibt solche Beispiele, aber dominierend war bis mindestens 1901 ganz klar der ß-lose Antiquasatz, übrigens häufig oder meistens einhergehend mit dem Verzicht auf Umlautversalien, genau wie in der Schweiz zum Teil bis heute. Der fatale staatliche Eingriff in die ss/ß-Schreibung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die Anwendung des ß gemäß Adelung außerhalb der Schweiz so sehr etabliert war wie nie zuvor. |
| nach oben | |
|
Sigmar Salzburg Dänischenhagen |
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2008 um 09.31 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3932 Die Verwendung des „Antiqua-ß“ war im deutschen Sprachraum auch im 19. Jahrhundert verbreitet – schon seit dem 16. Jhdt., zunächst nur in einzelnen Fachwörtern, als lang- und rund-s, kursiv als Ligatur geschrieben. Im Sinne der Austauschbarkeit mit der Frakturschrift wird dieses „ß“ selbst dann verwendet, wenn im Übrigen das lange „s“ nicht mehr im Gebrauch ist, z.B. im Antiqua-Druck von Kleists „Kohlhaas" 1808. In meiner Sammlung finde ich das in der „Gothischhochdeutschen Wortlehre“ von Adolf Ziemann 1834 oder im „Lesebuch für die oberen Klassen evangelischer Schulen", Schleswig 1877. Dort sind die Gedichte in Antiqua, die Prosa in Fraktur wiedergegeben. Letzteres zeigt, daß dies auch schulisch verbreitet wurde. Dennoch scheinen bis 1945 ß-lose Handschriftenproben zu überwiegen, wenn sie nicht gerade in der deutschen Kurrentschrift abgefaßt sind – z.B. von Kaiser Wilhelm, Einstein und Thomas Mann. |
| nach oben | |
|
Reinhard Markner Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2008 um 02.04 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3931 Die vermeintlich schweizerische durchgängige ss-Schreibung wurde mit wenigen Ausnahmen bereits im 19. Jahrhundert im Antiqua-Buchdruck verwendet; erst nach 1901 setzte sich hier die Verwendung der ss-Ligatur (Antiqua-ß) allmählich durch. Im Antiqua-Zeitungsdruck verschwand die durchgängige ss-Schreibung, wie sie das Berliner Tageblatt schon in den 1920er Jahren gepflegt hatte, endgültig wohl erst in den 1950er Jahren; die in bahnbrechend moderner Weise gestaltete Wochenzeitung Das Reich verwendete das Antiqua-ß bereits Anfang der 1940er Jahre (hier ein Beispiel aus der Goebbels-Kolumne). In daktylographischen Texten hielt sich die ss-lose Schreibung noch weitaus länger – auch nachdem flächendeckend Maschinen verwendet wurden, die das ß im Zeichenvorrat hatten. So wurde die in Schreibmaschinentypographie gestaltete »Hausmitteilung« des Spiegels erst am 23. 11. 1981 auf die ß-Schreibung nach Adelung umgestellt. In der voraufgehenden Nummer vom 16. 11. 1981 las man noch Ausmass, ausserstande, gewiss, liesse, schiessen. |
| nach oben | |
|
Klaus Achenbach Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2008 um 07.23 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3394 Lieber Herr Konietzko, Sie schreiben einerseits "Schreibweisen wie ‹aussen› und ‹Strasse› sind deshalb als Zeichen schweizerischer Eigenständigkeit gegenüber Deutschland besonders gut geeignet, weil sie eine phonetische Besonderheit des Schweizerdeutschen widerspiegeln"; andererseits "Aber es ging mir ja eigentlich gar nicht um Phonetik, sondern um Rechtschreibung. Selbst wenn Eisenbergs Begriff des Silbengelenks phonetisch nicht berechtigt ist: für die Erklärung, wann im Deutschen doppelte Konsonantenbuchstaben auftreten, ist er wohl nützlich". Reden wir nun über Phonetik oder über Orthographie? Wenn die Eisenbergsche Silbengelenktheorie "phonetisch nicht berechtigt ist", dann ist sie doch sinnlos. Sie soll doch gerade die orthographische Konvention der Konsonantenverdopplung phonetisch erklären, zumindest plausibel machen. Gerade in dieser Hinsicht ist der Gallmannsche Aufsatz sehr unklar. Wiederholt beruft er sich auf die Schreibung des Schweizerdeutschen. Die Phonetik wird dagegen allenfalls kursorisch behandelt. Dadurch hat seine Darstellung etwas Zirkuläres. Auch Ihre Unterscheidung zwischen "artikulatorisch" und "phonetisch" leuchtet mir nicht recht ein. Unterschiedliche Laute werden nun einmal durch unterschiedliche Artikulation erzeugt. Nehmen wir das Beispiel Rat-te. Nach meiner Selbstbeobachtung lege ich bei silbenbetonender Aussprache eine deutliche Pause (gewissermaßen ein Luftanhalten) zwischen Herstellung und Öffnung des Verschlusses ein, also Rat––te. Das müßte sich doch phonetisch, durch apparative Aufzeichnung der Tonwellen, nachweisen lassen. Im Gegensatz zu den Plosiven lassen sich Frikative verlängern. Da kann ich den Ton zwischen Herstellung und Öffnung der Verengung beliebig verlängern: schaffff-fen oder eben auch ruuffff-fen. Einen langen Vokal kann ich natürlich auch beliebig verlängern: ruuuu-fen. Deshalb halte ich eben die Silbengrenze zwischen langem Vokal oder Diphthong und stimmlosem Konsonanten für unbestimmt. |
| nach oben | |
|
Horst Ludwig St. Peter, MN, USA |
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2008 um 16.35 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3372 Sie haben völlig recht, lieber Herr Konietzko, wenn Sie auf den Unterschied "artikulatorisch/akustisch" hier hinweisen. Was ich hervorhebe, ist, daß "Silbe" gar nicht so einfach zum allgemeinen Gebrauch definiert ist, wie es der Vorschlag, "einfach gaaanz langsam zu sprechen", nahelegt. Wo ist bei "Ratte/summen/Säcke/Nässe/babbeln" die Silbengrenze, so daß sich Kinder zur Schreibung einfach nach der unbeklatschten Aussprache richten könnten? Da ein Verschluß-"Laut [...] erst durch das Lösen des Verschlusses" entsteht, — woran sieht — also hört — das arme Kind, wie man "addieren" und "Suppe" und "buddeln" schreibt? Und welche Hilfe gibt's für die Schreibanfänger bei "vielleicht"? Hier ist viel traditionelle Schreibkultur am Werken, und wenn man die zerstört, dann ist beim Schreibenlernen und bei der Schreibung einfach der Teufel los. Schon bei meinen Beiträgen zur Diskussion in der *SZ* (bevor die da abgewürgt wurde) habe ich immer für die "historische Schreibung" plädiert (wobei eine vorsichtige Anpassung an sinnvolle Neuerungen von Leuten, die schreiben können, durchaus am Platze ist). Also bin ich sogar fürs Silbenklatschen, — denn ich will, daß Kinder richtig schreiben lernen. Dazu müssen sie aber nicht erst lernen, daß eine Silbe aus einem Selbstlaut oder Zwieselbstlaut besteht, zu dem ihn umgebende Mitlaute gehören. Sowas ist dann schon eher Thema für die Sprachforschung. Von deren sachgerechten Ergebnissen jedoch sollten Reformer Kenntnis haben, bevor sie an einem Kulturgut herumfummeln, das sie offenbar nicht anständig angehen können, wenn sie erst bei den Schweizern endlich was finden, was auch vor der eigenen Haustür zu finden ist. |
| nach oben | |
|
David Konietzko Bad Homburg vor der Höhe |
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2008 um 11.54 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3369 »[...] schließe ich die erste Silbe, indem ich die Zunge zum Ansatz des ›t‹ am dental-alveolaren Teil der Sprechwerkzeuge h[e]be.« Aber dabei entsteht ja noch kein Laut, sondern erst durch das Lösen des Verschlusses. In #3347 hatten Sie gefordert, Silbengrenzen durch die Untersuchung »oszillographische[r] Aufzeichnungen« zu ermitteln. Damals war also ›Silbe‹ für Sie ein akustischer Begriff, jetzt ist es ein artikulatorischer. |
| nach oben | |
|
Horst Ludwig St. Peter, MN, USA |
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2008 um 10.49 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3368 Ich vermute, nein. Denn wenn ich "raten" natürlich (also nicht, um bewußt die "Silben" zu finden; das ist in unserer Kultur ja eine Erziehungsaufgabe) ganz langsam spreche, schließe ich die erste Silbe, indem ich die Zunge zum Ansatz des "t" am dental-alveolaren Teil der Sprechwerkzeuge habe. Ich schließe nicht das "a" ab und bewege dann erst die Zunge dorthin, wie ich das bei "Ah, das [...]" tue. Und auch Harsdörffer bemerkte das, weil der Name was mit "Dorf" zu tun hat und nichts mit "Dörre". So bizarr ist also die Erklärung für Opitz’ Schreibweisen gar nicht; denn das mit der »Letternhäufelung« liefert zwar ein einprägsames Wort für das, was das Auge sieht, aber es hat den Verstand vielleicht doch nicht ganz erreicht. Auch auf die Idee, Vokalkürze phonetisch durch Verdoppelung des folgenden Konsonantenzeichens zu kennzeichnen, woran wir heute beim Schreiben fest gewöhnt sind, muß man nämlich auch erstmal kommen. In ganz alten Zeiten war das "Silbengelenk" da doch auch an derselben Stelle, aber ein "m" in "genomen" wurde als hinreichend angenommen. — Aber: Die Verschriftung heute so nahe wie möglich an der Lautung zu orientieren, das ist schon kompliziert. Zu kompliziert jedenfalls für die Reformschriebentwickler. Deshalb geht bei denen auch so viel durcheinander. Bei Achenbachs Gedanken hierzu aber nicht. |
| nach oben | |
|
David Konietzko Bad Homburg vor der Höhe |
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2008 um 10.38 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3360 Es wäre nicht ganz auszuschließen, daß die schweizerdeutsche Silbengelenk-Regel damals auch im Schlesischen (und in weiteren deutschen Mundarten) galt und erst später auf das Schweizerdeutsche eingeschränkt wurde. Eine weniger an den Haaren herbeigezogene Erklärung für Opitz’ Schreibweisen ist vielleicht die barocke Sitte der »Letternhäufelung« (so der Barockdichter Harsdörffer, dessen Name gleich ein Beispiel dafür bietet). Unter Explizitlautung versteht man eine Sprechweise, die zwar ›unnatürlich‹, aber psychisch real ist, d.h. als die ›eigentliche‹ empfunden wird. Sie wird sogar in Gesprochenes ›hineingehört‹. Diese Explizitlautung scheint mir für Schreibentscheidungen relevanter zu sein als die ›natürlichere‹ Umgangslautung. In Explizitlautung syllabiert man jedenfalls ra-ten. Jetzt fragt sich noch, ob die Explizitlautung wirklich nur etwas im (Rechtschreib-)Unterricht Antrainiertes ist. Man spricht ja auch im Alltag raten unter Umständen etwas langsamer und mit einem deutlich zur zweiten Silbe gehörenden t aus (etwa bei verständnisbehindernden Hintergrundgeräuschen oder zur Hervorhebung). Es wäre zu überprüfen, ob das auch schon kleine Kinder tun, die noch nicht zur Schule gehen. Ich vermute, ja. |
| nach oben | |
|
Horst Ludwig St. Peter, MN, USA |
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2008 um 05.15 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3359 Mein Beitrag (#3347) sollte Achenbachs gar nicht zu schöne Theorie unterstützen. Natürlich: »"greiffen, lauffen; diese Schreibungen passen genau zur dialekten Syllabierung.« Aber auch der Schlesier Martin Opitz muß die Verdoppelung von Konsonantenbuchstaben nach langen Vokalen und Diphthongen ja irgendwo herhaben: "Vnter dessen laufft die Bach" "Wil ich in den süssen safft" (wo er doch sonst durchaus auch das "ß" verwendet: "Vnd vergiß des Zuckers nicht; ...") "Kauffe gleichfals auch melonen" »Allgemeiner möchte [Achenbach] behaupten, daß die Silbenfuge bei stimmlosem Konsonanten (also „fortis“ in standarddeutscher Aussprache) nach langem Vokal oder Diphtong unbestimmt ist. Das bedeutet, dass man z.B. „raten“ phonetisch durchaus auch „ra:t-ten“ trennen könnte.« Und das behaupte ich auch. Wir dürfen nicht vergessen, daß auch der "Standard" nur ein Typ der deutschen Sprache ist, und noch dazu ein gelehrter. So langsam, daß in meinem "raten" das "t" nur zur zweiten Silbe gehört und das "m" in "brummen" klar zu beiden, spreche ich eben nicht; es wäre unnatürlich. Ich hatte woanders hier schon mal darauf hingewiesen, daß ich "Hütte" mit verlängertem Vokal in der ersten Silbe und dem "t" nur in der zweiten Silbe sprechen könnte, und trotzdem würde kein "Hüte" daraus. Aber Herr Konietzko hat recht; hier geht es "ja eigentlich gar nicht um Phonetik, sondern um Rechtschreibung" — und wie die gelehrt wird! |
| nach oben | |
|
Reinhard Markner Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2008 um 02.05 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3358 Gallmanns Aufsatz trägt bekanntlich den Titel »Warum die Schweizer weiterhin kein Eszett schreiben«, verspricht also eine Antwort auf die Frage »Warum schreiben die Schweizer weiterhin kein Eszett?« Die richtige Antwort lautet, wie Gallmann zweifellos bekannt war: »Weil die EDK nicht bereit war, im Zuge der Rechtschreibreform das ß, wenn auch nur in der pseudo-Heyseschen Verwendungsweise, an den Schweizer Schulen einzuführen.« Gallmann gibt in Wirklichkeit nur eine Antwort auf die Frage, ob dieser Entscheid aus phonetischer Sicht in Ordnung geht. |
| nach oben | |
|
David Konietzko Bad Homburg vor der Höhe |
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2008 um 01.22 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3357 Mir fehlen die technischen Möglichkeiten, um selbst phonetische Untersuchungen durchzuführen. Ich muß mich daher auf die Fachliteratur verlassen. Den Begriff des Silbengelenks hat Eisenberg in die Phonetik eingeführt und für die Beschreibung der Verdopplung von Konsonantenbuchstaben nutzbar gemacht (siehe seinen ›Grundriss der deutschen Grammatik. Band 1: Das Wort‹). Herr Ickler stellt die Sache in seinem Wörterbuch ›Normale deutsche Rechtschreibung‹ (Abschnitt ›Die Hauptregeln der Orthographie‹) im wesentlichen wie folgt dar: »Im allgemeinen wird ein Konsonant doppelt geschrieben, wenn er zu zwei Silben gleichzeitig gehört (›Silbengelenk‹); dann ist der vorhergehende Vokal kurz.« (§ 2 [5]) »Die Verdoppelung von Konsonantenbuchstaben als Zeichen für Silbengelenke bleibt in anderen Formen erhalten, auch wenn kein Silbengelenk mehr vorliegt: stammt wegen stammen.« (§ 3) Herr Achenbach schreibt (#3345): »Ich sehe phonetisch keinen Grund, nicht auch groß-ße (oder gros-se) zu trennen. Das hätte den Vorteil, daß die geschlossene Stammsilbe erhalten bleibt.« Silbengrenzen nehmen keine Rücksicht auf die morphologische Grenze zwischen Stamm und Flexionssuffix (morphologisch Hund-e, phonetisch Hun-de). »Außerdem verstößt die Trennung gro-ße gegen die Regel, daß der anlautende s-Laut im Deutschen stimmhaft ist.« Das gilt aber auch für gros-se (mit Silbengelenk). Die Regel gilt streng nur für wortanlautendes s, nicht für silbenanlautendes. Es gibt zwar wohl die Neigung, daß Silbenanlaute möglichst als auch Wortanlaute vorkommen sollen, aber eben nur als Neigung. – groß-e verstößt gegen die Regel, daß deutsche Sprechsilben mit einem Konsonanten beginnen müssen (zumindest mit Glottisschlag). Herr Ludwig schreibt (#3347): »Und wenn die Schweizer Kinder im Schreibunterricht silbenbeklatscht ›gros-sen‹ lernen, dann tun sie das, um die Worttrennung am Zeilenende zu lernen.« Aber laut Gallmann wird im Schweizerdeutschen jeder Fortis-Konsonant zwischen zwei Vokalen ambisyllabisch realisiert, also z.B. auch das [f] in saufen, obwohl man natürlich auch in der Schweiz am Zeilenende ‹sau-fen› trennt. Die schweizerdeutsche Silbengelenk-Regel ist also nichts in der Schule bloß um der Rechtschreibung willen Antrainiertes. Aber es ging mir ja eigentlich gar nicht um Phonetik, sondern um Rechtschreibung. Selbst wenn Eisenbergs Begriff des Silbengelenks phonetisch nicht berechtigt ist: für die Erklärung, wann im Deutschen doppelte Konsonantenbuchstaben auftreten, ist er wohl nützlich. Meine ursprüngliche Hauptaussage war: Es ist nicht »etwas krampfhaft« (wie Florian Coulmas meint), sondern sinnvoll, daß wir ‹außen› und nicht ‹aussen› schreiben, denn wir schreiben ja auch nicht *‹lauffen›. (Es ist auch sinnvoll, ‹Schluß› und ‹daß› zu schreiben, aber aus anderen Gründen.) (Übrigens: »Entsprechend unterlaufen weniger routinierten« [Schweizer] »Schreibern gar nicht so selten Fehlschreibungen wie greiffen, lauffen; diese Schreibungen passen genau zur dialekten Syllabierung.« [S. 5, Fn. 11 in Gallmanns Aufsatz]) |
| nach oben | |
|
David Konietzko Bad Homburg vor der Höhe |
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2008 um 00.25 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3356 Herr Markner forderte offenbar (mit Recht) eine Erklärung für Eszettlosigkeit, die nicht nur auf schweizerdeutsche Besonderheiten Bezug nimmt. Mit meiner Antwort (#3353) wollte ich nur klarstellen, daß die Erklärung dennoch mindestens eine Komponente aufweisen muß, die nur in bezug auf die Schweiz zutrifft – das könnte (unter anderem) Gallmanns Silbengelenk-Theorie sein. Daß diese allein nicht hinreicht, hatten wir ja schon geklärt. |
| nach oben | |
|
Reinhard Markner Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2008 um 00.20 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3355 Der Verzicht auf das ß hat sich nicht durchgesetzt, sondern er wurde durchgesetzt, auf politischem Wege. In ihrem Bemühen um die typographische Landesverteidigung lagen die Schweizer intuitiv richtig: Vor die Frage gestellt, ob die künftige »Normalschrift« ein ß aufweisen solle oder nicht, entschied sich Hitler wenige Jahre später für das ß. Mit dem Antiqua-Duden von 1942 erfolgte insofern eine folgenschwere Weichenstellung. Ungeklärt ist bisher aber noch, ob das ß in der lateinischen Schreibschrift überhaupt jemals flächendeckend eingeführt wurde – in Deutschland vor der Vereinheitlichung der Fibeln durch das Reichserziehungsministerium und in der Schweiz vor dem besagten Entscheid des Kantons Zürich. Das ist keineswegs sicher bzw. sogar eher unwahrscheinlich. |
| nach oben | |
|
Urs Bärlein * |
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2008 um 00.07 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3354 Erklärungsbedürftig ist nicht, warum sich das Eszett bzw. das scharfe "s" in Deutschland gehalten hat. Es erfüllt bzw. erfüllte dort eine wichtige Aufgabe: die Häufung dreier gleicher Konsonanten zu vermeiden (jedenfalls bis zur Reform, die es in dieser Funktion auf Wörter wie "Maßstab" beschränkt). Erklärungsbedürftig ist allenfalls, warum die Schweizer das "ß" aufgegeben haben. Peter Gallmann bietet dafür eine Erklärung an. Diese reicht aber nicht zu. |
| nach oben | |
|
David Konietzko Bad Homburg vor der Höhe |
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2008 um 23.27 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3353 Aber dann ist doch die Frage, warum sich der Verzicht aufs Eszett in der Schweiz letztlich durchgesetzt hat und in Deutschland nicht. Gallmann selbst räumt ja ein, daß es neben der Schweizer Silbengelenk-Regel noch weitere Gründe gegeben haben kann: »Die Traditionen der Antiquaschriften und die Zwänge der mechanischen Schreibmaschinen mögen ja durchaus mit eine Rolle gespielt haben, dass in der Schweiz ohne Eszett geschrieben wird.« (S. 2 seines Artikels) |
| nach oben | |
|
Reinhard Markner Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2008 um 16.20 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3352 Weil die heute in der Schweiz übliche Schreibweise lange Zeit auch in anderen Teilen des deutschen Sprachraums verbreitet war. Betrachtet man sie von diesem Usus isoliert, kommt man leicht zu falschen Schlüssen. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2008 um 14.13 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3351 Warum sollte sie das? |
| nach oben | |
|
Reinhard Markner Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2008 um 13.41 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3348 Gallmanns Konstruktion erklärt auch nicht, weshalb sich Rot-Weiss Essen seit 1923 so und nicht anders schreibt. |
| nach oben | |
|
Horst Ludwig St. Peter, MN, USA |
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2008 um 05.26 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3347 Herrn Achenbachs Theorie ist nicht "zu schön, um wahr zu sein"; sie hat eine Menge für sich, und Prof. Gallmanns These hat das nicht. Für letztere müßte man oszillographische Aufzeichnungen von ganz normalen Sprechsituationen genauestens studieren. Daß sich Silben nämlich durch ganz langsames Sprechen erkennen lassen, das stimmt eben nicht. Dieses ganz langsame Sprechen zur Silbenerkennung ist eben kein natürliches Sprechen; und das grundschulische Silbenklatschen ist gut für die schriftliche Abtrennung am Zeilenende, aber nicht fürs natürliche Sprechen. Die Ramsauer können ein Lied davon singen. Es ist nämlich richtig, daß man "„raten“ phonetisch durchaus auch „ra:t-ten“ trennen könnte"; denn wenn ich das [t] ans Ende der ersten Silbe setze, setzen wir nicht neu an fürs [t] am Beginn der nächsten Silbe, genau wie wir auch bei "genommen" den bilabialen Konsonanten nicht neu ansetzen (und erste Schreibweisen des Deutschen kennzeichneten noch nicht Kürze des Vokals mit verdoppelter Schreibung des folgenden Konsonanten, meinten aber dieselbe Lautung). Wenn heute etwas "stoßsicher" ist, dann wird sogar das "s" von "sicher" nicht stimmhaft ausgesprochen. Die Definition von Silbe ist eindeutig; ihre genaue Bestimmung in einem Worte ist es nicht immer. Da funkt uns eine Menge Vorwissen dazwischen — fürs Schreiben, und das ist gut. Beim Sprechen brechen wir uns aber nicht die Zunge ab bei "Schlu*ßs*egen" und folgen "sta*ttd*essen" einfach Muttern und den Loisachern, die offenbar entweder nichts von der Auslautverhärtung mitbekommen haben oder aber die Silbengrenze alter Zeit wie die Engländer alter Zeit nicht überall anerkennen (a naperon –> an apron), und andern, die uns ganz natürlich über den Weg kommen [ve:komn] oder über den See kommen [ze:komn]. Letzteren Unterschied beachten wir nicht weiter, denn wir haben es klar mit zwei getrennten Sinnträgern (freien Morphemen) zu tun, und es gibt hier auch kein Wort am Ende einer Zeile zu trennen. Das ist aber bei Gallmanns Schweizer "im grossen" nach langem Vokal nicht der Fall. Der langen Rede kurzer Sinn: Ob wer "größ/ßer" oder "grö-ßer" silbiert und "ra:t/ten" oder "ra:ten", hat mit dem Grundschullehrer zu tun, nicht mit der Muttersprache. Denn selbst wer in hoher Sprachschulung für die Bühne und die Kanzel in dieser Hinsicht endlich "richtig" sprechen gelernt hat, spricht, sobald er wieder unterm Volke ist, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und da hören sich die fraglichen Silben ganz anders an. Und wenn die Schweizer Kinder im Schreibunterricht silbenbeklatscht "gros-sen" lernen, dann tun sie das, um die Worttrennung am Zeilenende zu lernen. Daß der Lehrer dabei nicht darauf hinweist, "daß der [silben-]anlautende s-Laut [vor Vokalen] im Deutschen stimmhaft ist", ist verständlich; denn ums natürliche Sprechen geht's in *der* Unterrichtseinheit weder in den Schweizer noch in den deutschen Grundschulen. Das hat Gallmann wohl übersehen. |
| nach oben | |
|
Klaus Achenbach Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2008 um 00.48 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3345 Die These von Prof. Gallmann ist ja sehr reizvoll, da sie einen tieferen sprachlichen Grund für den Schweizer Verzicht auf das Eszett aufzuzeigen scheint. Das wäre befriedigender, als diesen Verzicht als bloße historische Zufälligkeit aufzufassen. Ob die Hypothese zutrifft, ist natürlich eine andere Frage, zu der ich mich mangels näherer Kenntnis des Schweizerdeutschen nicht äußern will. Bezweifeln möchte ich allerdings, daß die Silbenfuge im Standarddeutschen notwendigerweise anders liegt, die schweizerische Trennung also im Standarddeutschen notwendigerweise phonetisch „systemwidrig“ (Konietzko) wäre. Nehmen wir das Wort „groß“, eine lange geschlossene Silbe. Regelgerecht wird gro-ße getrennt. Ist das phonetisch aber wirklich zwingend? Ich sehe phonetisch keinen Grund, nicht auch groß-ße (oder gros-se) zu trennen. Das hätte den Vorteil, daß die geschlossene Stammsilbe erhalten bleibt. Außerdem verstößt die Trennung gro-ße gegen die Regel, daß der anlautende s-Laut im Deutschen stimmhaft ist. Ähnlich gelagert ist auch die Frage der Silbenfuge nach Diphtong (wei-ße oder weis-se). Anders sehe ich die Frage bei stimmhaftem s-Laut. So sehe ich die Trennung Na-se als die Natürliche an, weil stimmhaftes s nicht auslautend auftreten kann. Allgemeiner möchte ich behaupten, daß die Silbenfuge bei stimmlosem Konsonanten (also „fortis“ in standarddeutscher Aussprache) nach langem Vokal oder Diphtong unbestimmt ist. Das bedeutet, dass man z.B. „raten“ phonetisch durchaus auch „ra:t-ten“ trennen könnte. Solche Trennungen wirken zweifellos sehr ungewohnt, was aber wohl daran liegt, daß wir so an die orthographischen Konventionen der Silbentrennung gewöhnt sind, daß wir sie auch für phonetisch zwingend halten. Ich bin mir darüber im klaren, daß meine Auffassung schwer mit der Silbenfugentheorie der ss-ß-Schreibung zu vereinbaren ist. Dabei finde ich diese Theorie sehr schön. Vielleicht ist sie aber zu schön, um wahr zu sein? |
| nach oben | |
|
Verschoben |
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2008 um 14.14 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=185#3323 Kommentar von R. M., verfaßt am 17.05.2008 um 17.41 Uhr Vielen Dank, Herr Eversberg. Der Blick in Roman Loosers Dissertation lohnt immer wieder, ob zum Zwecke der Belehrung oder dem der Belustigung. Ob seine Darstellung überhaupt zutrifft, wäre zu prüfen. Im übrigen ist natürlich Zürich zwar der bevölkerungsreichste Kanton, aber eben doch nur einer unter vielen. Looser selbst deutet an, daß andere Kantone das ß in der lateinischen Schreibschrift bereits abgeschafft oder gar nie eingeführt hatten. Das Typenhebel-Argument mag auch dort vorgebracht oder vorgeschoben worden sein – oder eben nicht. Den Unterschied zwischen Antiqua und Fraktur bzw. lateinischer und deutscher Schreibschrift kann man in diesem Zusammenhang nicht genug betonen. Im Antiquasatz einschließlich maschinenschriftlicher Texte hat sich der Gebrauch des ß erst in den 1960er Jahren endgültig durchgesetzt – während er gleichzeitig in der Schweiz marginalisiert wurde. Kommentar von David Konietzko, verfaßt am 17.05.2008 um 14.07 Uhr Herrn Markners Erklärung läßt sich mit meiner verbinden: Schreibweisen wie ‹aussen› und ‹Strasse› sind deshalb als Zeichen schweizerischer Eigenständigkeit gegenüber Deutschland besonders gut geeignet, weil sie eine phonetische Besonderheit des Schweizerdeutschen widerspiegeln. Bei der Entscheidung des Züricher Erziehungsrates können auch unbewußte Gründe eine Rolle gespielt haben. Herr Ickler schreibt in seinem Kritischen Kommentar zur ›Neuregelung der deutschen Rechtschreibung‹ (2. Auflage): »[D]ie bewußten Gründe einer Änderung oder Normierung waren nicht immer die tatsächlich wirksamen« (S. 2 der unter http://www.vrs-ev.de/KritKomm.pdf zugänglichen pdf-Datei). Zur Erklärung mit der angeblichen Eszettlosigkeit der Antiqua schreibt Gallmann: »Zu dieser Begründung ist zu bemerken, dass zumindest seit dem Ende des 19. Jahrhunderts das Eszett auch in Antiquaschriften voll etabliert war und in der Buchproduktion auch der Schweiz verwendet wurde.« (Fußnote ausgelassen.) »Darüber hinaus wurden gerade die Zeitungen – wohl die häufigste tägliche Lektüre – in der Schweiz bis Ende der 40er-Jahre dieses Jahrhunderts (also länger als in Deutschland) in Fraktur und deshalb auch mit Eszett gesetzt; das Eszett war den damaligen Lesenden also durchaus vertraut.« (S. 1/2 der in #12133 genannten pdf-Datei) Die allmähliche Durchsetzung des Beschlusses des Züricher Erziehungsrates im allgemeinen Schreibgebrauch dürfte also durch weitere Faktoren begünstigt worden sein, z.B. durch die schweizerdeutsche Silbengelenk-Regel oder den Wunsch nach Abgrenzung vom nationalsozialistischen Deutschland. Kommentar von b.eversberg, verfaßt am 17.05.2008 um 07.55 Uhr Gescheiterte Rechtschreibreformen in der Schweiz : die Geschichte der Bemühungen um eine Reform der deutschen Rechtschreibung in der Schweiz von 1945 bis 1966" von Roman Looser (Frankfurt: Lang, 1995, ISBN 3-631-48834-3): "Am 5. Juli 1938 kam es in der Sitzung des Zürcher Erziehungsrates zu einer lebhaften Debatte über die Frage, ob das Scharf-s in der Schule beizubehalten sei oder nicht. Das Begehren zur Abschaffung kam aus der Lehrerschaft. Der Erziehungsrat liess sich davon überzeugen, dass es aus praktischen Gründen (die schweizerischen Schreibmaschinen weisen das Scharf-s nicht auf) sinnvoll sei, das Scharf-s durch ss zu ersetzen, und wies die Lehrkräfte aller Schulstufen an, dies im Unterricht anzuwenden (...) In der Folge setzte sich der Gebrauch des ss anstelle des Scharf-s allmählich durch, was nicht erstaunt, da in anderen Kantonen das Scharf-s seit je nur in der Fraktur, nicht aber in der heute allein üblichen Antiqua geschrieben wurde." Kommentar von R. M., verfaßt am 17.05.2008 um 00.25 Uhr Das ß wurde in den Schulen der Schweiz zu einer Zeit abgeschafft, als das Bedürfnis nach Distanz vom „großen Kanton“ sehr stark war. (Mit den Typenhebeln hatte die Sache nichts zu tun, schließlich lernen Grundschüler nicht an der Schreibmaschine.) Kommentar von David Konietzko, verfaßt am 16.05.2008 um 22.02 Uhr Es lohnt sich wohl nicht, für eine marginale Art der Schriftauszeichnung eigens einen neuen Buchstaben einzuführen. In der Tat gibt es zwei Verwendungen des Eszett: erstens für stimmloses s zwischen betontem Langvokal / Diphthong und Schwa, zweitens für das Silbengelenk ‹ss› in Nichtgelenkposition. (Als Einzelfall wäre noch die Verwendung in der Unterscheidungsschreibung daß – das hinzuzufügen.) Für das Verschwinden des zweiten Eszett in der Schweiz müßte eine weitere Erklärung geliefert werden; aber das heißt nicht, daß die schweizerische Silbengelenk-Regel nicht auch eine Rolle gespielt haben kann. Siehe auch folgende Stellen in Gallmanns pdf-Datei: »Die Traditionen der Antiquaschriften und die Zwänge der mechanischen Schreibmaschinen mögen ja durchaus mit eine Rolle gespielt haben, dass in der Schweiz ohne Eszett geschrieben wird. Aber wenn die Schweizer das Eszett für einen wichtigen Buchstaben gehalten hätten, hätten sie auf den Schreibmaschinentastaturen ganz sicher ein anderes Zeichen gefunden, auf das man zu Gunsten des Eszett hätte verzichten können. Und im Schriftsatz war das Eszett ja sowieso vorhanden. Ich möchte darum vermuten, dass ein wirkungsvollerer, aber auch versteckterer Grund für den schweizerischen Usus besteht.« (S. 2) »Bei den schweizerischen Typografenlehrlingen, die ich im Hinblick auf die Buchproduktion in der Eszett-Schreibung unterrichte, beobachte ich immer wieder, dass auch diejenigen, die die Eszett-Regeln eigentlich perfekt beherrschen, in der Trennung Eszett in Doppel-s auflösen: reißen –> reis-sen. Die dialektale Silbengelenk-Regel ist also so stark, dass sie das angelernte Wissen überspielen kann.« (S. 5, Fn. 12) Niemand hat behauptet, die Schweizer hätten das Eszett aus sprachwissenschaftlichen Erwägungen heraus aufgegeben. Das Verschwinden des Eszett in der Schweiz ist ja meines Wissens nicht das Ergebnis bewußter Sprachplanung. Systematisierungstendenzen können unbewußt wirken. So liest man gelegentlich ‹Grafitti›. Auch hierbei handelt es sich (wenn man die kurze Aussprache des i zugrunde legt) um eine Anpassung an das deutsche Schreibsystem (doppelte Konsonantenbuchstaben bei Silbengelenken), aber der Verfasser hat bestimmt keine sprachwissenschaftlichen Überlegungen angestellt. Aber eigentlich wollte ich nicht so sehr das Verschwinden beider Arten des Eszett in der Schweiz begründen, als vielmehr Coulmas’ Begründung des Fortbestandes der ersten Art in Deutschland durch eine bessere ersetzen. Kommentar von b.eversberg, verfaßt am 16.05.2008 um 21.22 Uhr Die Schweizer gaben das ß nicht aus sprachwissenschaftlichen Erwägungen heraus auf, sondern weil die industriell standardisierten mechanischen Schreibmaschinen einen Typenhebel zuwenig hatten. Man mußte entscheiden, auf welches Zeichen man am besten verzichten konnte. Die Sprachwissenschaft hatte damit meines Wissens exakt gar nichts zu tun. Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 16.05.2008 um 20.18 Uhr Wäre das "ss" zwischen langem betontem Vokal/Diphthong und schwach betontem Vokal im Deutschen so systemwidrig bzw. wäre eine solche Systemwidrigkeit wirklich von orthographischem Belang, hätten die Deutschen schon längst ein versales "ß" erfinden müssen, nicht erst das DIN nach der Reform. Gallmanns Darstellung ist konstruiert, weil er die Reformorthographie zugrundelegt und damit nur diejenigen Verwendungen des "ß" berücksichtigen kann, die es dort findet. Für die Subsistenz des "ß" im Deutschen (im Unterschied zum Italienischen, das hier eher zum Vergleich taugt) gibt es diesseits aller Systematik einen ganz simplen Grund (wenn nicht damit zugleich schon eine hinreichende Erklärung): Es verhindert die Häufung von drei gleichen Konsonanten (eine Funktion, in der es durch die Reform allerdings stark beeinträchtigt wurde). Soweit Gallmann den Verzicht der Schweizer auf das "ß" aus einer phonetischen Besonderheit herleiten will, müßte er ebenfalls erklären, warum seine Landsleute auf die Verwendung dieses Graphems nicht nur hinter langen, sondern auch hinter kurzen Vokalen verzichtet haben. Phonetik gibt dafür nichts her. Und fest steht ja immerhin, daß die Schweizer das "ß" zu einem Zeitpunkt aufgaben, da in Deutschland die s-Schreibung nach Adelung unangefochten war. Kommentar von David Konietzko, verfaßt am 16.05.2008 um 19.10 Uhr Coulmas’ Erklärung für das deutsche Festhalten am Eszett leuchtet schon deshalb nicht ein, weil man in Deutschland schweizerische Schreibweisen wie ‹Strasse› kaum einmal sieht (außer als Schreibfehler), so daß wir für nationale Abgrenzungsgelüste keinen Anlaß haben. Schweizer Verlage, die in Deutschland verkaufen wollen, verwenden ja meines Wissens das Eszett. Wieviele Deutsche wissen überhaupt von der schweizerischen Eszettlosigkeit? Nach Peter Gallmann (http://www.personal.uni-jena.de/~x1gape/Pub/Eszett_1997.pdf) ist der orthographische Unterschied in einer phonetischen Besonderheit des Schweizerdeutschen begründet. Zwischen betontem Langvokal / Diphthong und Schwa sind stimmloses und stimmhaftes s bedeutungsunterscheidend (Muße : Muse, reißen : reisen); deshalb ist es sinnvoll, daß es in dieser Position neben ‹s› für stimmhaftes s noch ein eigenes Graphem für stimmloses s gibt. Hierfür kommt in Deutschland nur ‹ß› in Frage; ‹ss› wäre ein Systemverstoß, weil Verdoppelung eines Konsonantenbuchstabens sonst nur als Kennzeichen für Silbengelenke dient (und dann wegen des Stammprinzips ausgeweitet wird: ‹Mann› wie ‹Mannes›). In Deutschland gehört der Laut [s] in Straße, außen usw. aber nur zur zweiten Silbe, und es sind auch keine verwandten Wortformen oder Wörter in Sicht, in denen er ein Silbengelenk wäre; deshalb wären ‹Strasse› und ‹aussen› hier systemwidrig. Im Schweizerdeutschen hingegen gehört in solchen Wortformen das [s] zu beiden Silben, so daß hier ‹Strasse› und ‹aussen› ins System passen. Kommentar von Matthias Künzer, verfaßt am 16.05.2008 um 16.07 Uhr „Die Differenzfunktion der Schrift ist identitätsbildend. Dabei geht es nicht um den Inhalt der Nachricht, sondern um den Anspruch der Gruppe auf Eigenständigkeit. So erklärt sich etwa das deutsche Beharren auf dem ß, mit dem man sich (etwas krampfhaft) von der Schweiz unterscheidet.“ (Florian Coulmas) Ist es wegen der schieren Größenverhältnisse nicht doch eher andersrum, nämlich daß die Schweiz gegenüber dem großen Deutschland auf eine eigene Identität Wert legt? Daß dies mittels krampfhaften Beharrens auf dem Doppel-s geschieht, bezweifle ich allerdings auch. |
| nach oben | |
Zurück zur Themenübersicht | nach oben | |